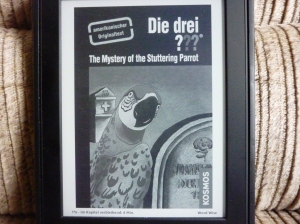Ein Mann spaziert, die Hände in den Taschen, ein Schritt vor den anderen, gemächlich, gemütlich, bei Sonne und Wind, Regen und Schnee. Bunte Blätter wirbeln um seine Füße, weiße Flocken legen sich auf seine Schultern, Kinder rennen spielend durch die Straßen, über die Felder, lassen Papierflieger kreisen, lachen.
Mal mit Hund, mal mit Frau, meist allein, den Kopf in den Wolken, tagträumend ohne Grenzen. Mit nackten Füßen auf den Baum kletternd, ausgebreitet im Gras liegend, die Wonnen der eigenen Kindheit vor Augen, vollkommen entschleunigt, abseits des Bürostresses, von gesellschaftlichen Verpflichtungen und all der anderen Hektik.
Neue Städte, egal ob im Urlaub oder neu hingezogen, erkunde ich am liebsten zu Fuß, und gehe auch sonst gerne wandern. Während Autos hupend an einem vorbeisausen, Fußgänger nur noch auf ihr Smartphone starren und die Stadt in ihren Abläufen so konstruiert ist, dass sie am Besten funktionieren würde, wenn es gar keine Menschen gäbe, ist das Flanieren der beste Weg hinter die Fassaden zu schauen, einen Blick für die einfachen Dinge des Alltages zu bekommen.
Jiro Taniguchis Der spazierende Mann ist im Original aus dem Jahr 1992, da gab es noch keine Smartphones und die Digitalisierung stand in ihren Kinderschuhen, aber die 80er-Jahre waren gerade erst vorbei. Jenes Jahrzehnt, in dem die japanische Wirtschaft unheimlich an Fahrt gewann und Nippon zu einer der führenden Technologienationen aufstieg. Man dachte, die Zukunft würde japanisch werden, so wie in William Gibsons Neuromancer.
Taniguchi lässt seinen Protagonisten aus diesem Hamsterrad hinaustreten. Mit seiner Frau zieht er in eine kleine Stadt, in ein putziges Häuschen mit papierbezogenen Wänden und einem knuffigen Hund vom Vormieter. Und dann geht er einfach los, ohne viel Worte, mal hierhin, mal dorthin, bei Wind und Wetter. Jeder Spaziergang nur ein paar Seiten, doch immer mit einer eigenen Geschichte, die man teilweise zwischen den Panels findet.
Und genauso entspannt habe ich das Buch gelesen, jeden Tag einen Spaziergang, ein Kapitel, lässig liegend, während das Panorama der Zeichnungen auf mich einwirkte. Eine wunderbare Ode an da Spaziergehen, das sich Vertrautmachen mit der Umgebung, das Genießen der Landschaft und der kleinen Dinge des Alltags.
Hier geht es zu meiner Besprechung von Jiro Taniguchis Vertraute Fremde.